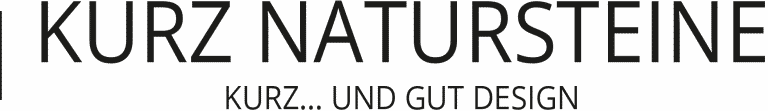In städtischen Wohngegenden erobern immer mehr urbane Gärten Terrain. Die Sehnsucht nach mehr Naturerlebnissen führt dazu, dass selbst kleinste Balkons oder Dachflächen bepflanzt werden. In Großstädten wie New York geht man dazu über, auf Wolkenkratzern urbane Parkanlagen anzulegen, die Menschen aus der Umgebung als Naherholungsareale dienen. Die Anfahrt zu einem Naturpark wäre im weitläufigen Amerika zu aufwändig und würde manchmal Stunden dauern. Der Central Park ist zu klein angesichts der zunehmenden Bedürfnisse nach Naturkontakt.
Der Begriff “Urban Farming” macht auch in Deutschland die Runde. Vielleicht ist dieser Trend der zunehmenden Verstädterung und Sinnentleertheit des Arbeitsalltags geschuldet, vielleicht aber auch der Erkenntnis, dass Naturkontakt die Seele heilt. Man pflegt zusammen mit den Nachbarn kleine Stadtgärten im Hinterhof, bepflanzt Flächen rund um Straßenbäume oder begrünt ungenutzte Garagendächer. Urbane Landwirtschaft ermöglicht jedem, seinen Kartoffelacker und seine Tomatenzucht irgendwo zu haben. Selbst Schulhöfe werden beackert, damit die Kinder einen Bezug zur Herstellung von Lebensmitteln bekommen.
Urbane Gärten ermöglichen die Selbstversorgung
Urbane Gärten reflektieren einen neuen Trend hin zur teilweisen Selbstversorgung. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Transportable Hochbeete oder in Kisten gestapelte Anzuchtbeete ersetzen die konventionellen Anbauweisen. Neben Nutzpflanzen sind auch Blühpflanzen im Stadtgebiet gefragt. Einzig ein wenig Zierkies aus Naturstein unterbringt zeitweise das grüne Kleinbeet. Parks werden mit Obstbäumen bepflanzt, damit die Öffentlichkeit davon profitiert.
In Berlin kann man einen fertig bepflanzten Gemüsegarten pachten. Der Begriff vom “Guerilla Gardening” erweitert die urbanen Spielräume noch. Hier wird die politische Aussage wichtiger als der Zeitverteib in städtischen Naturarealen. Das Beackern von Grünstreifen und die Rückeroberung von unbebauten Brachflächen zum Nutzen der Menschen enthält eine Botschaft, die vielen Stadtvätern nicht gefällt.
In den USA schon lange bekannt
“Urban Farming” und “Guerilla Gardening” stellen neuzeitliche Phänomene in Deutschland dar, nicht aber in den USA. Hier sind sie bereits seit den siebziger Jahren bekannt und werden von viel Prominenz unterstützt. Gärten dienen nicht nur der Erholung oder Selbstversorgung. Sie sind auch Kommunikations- und Begegnungszentren. Die seelische Verkümmerung des Menschen ohne Naturbezug ist unübersehbar. Dem steht aber auch ein zunehmender Verlust der Artenvielfalt gegenüber, den die Mehrheit als inakzeptabel empfindet.
Alles zusammen erklärt die stille Revolution, die mit dem urbanen Gärtnern einhergeht. Viele Aspekte fließen hier zusammen. Die zunehmende Verarmung der Natur steht der sozialen Not vieler Bürger gegenüber. Man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn man auf kleinstem Raum einen urbanen Garten anlegt. Vermehrtes Umweltbewusstsein kann ebenfalls ein Grund sein, warum man lieber Tomaten vom eigenen Balkon isst statt lange Transportwege und künstliche Nachreifungsverfahren zu akzeptieren.

Das Klima profitiert
Mini-Gewächshäuser lösen Platz- und Klimaprobleme elegant. Der Komposteimer wird gleich an Ort und Stelle zum Nutzen des Mini-Ackers eingesetzt. Ganz nebenbei kann urbanes Gärtnern aber auch für eine Verbesserung des innerstädtischen Mikroklimas sorgen, einen beachtlichen Beitrag zur Artenvielfalt leisten oder nachhaltige Lebensstile initiieren. Zudem ist Gärtner als Stressausgleich auch psychisch wichtig. Vorbilder für das urbane Gärtnern gab es allerdings bereits im Zweiten Weltkrieg.
Bürger suchten sich damals geschützte Ecken in öffentlichen Parks oder Wäldern, um heimlich Kartoffeln oder anderes anzubauen. In Paris kannte man im 19. Jahrhundert Stadtgärten, in denen Pariser Gemüse und Obst anbauten. Berühmt wurden die “Victory Gardens” in Großbritannien. Auch in Amerika oder Kanada forderte man damals die Bevölkerung auf, auf jeder verfügbaren Freifläche Anbau zu betreiben. So neu ist das “urban gardening” also nicht.
Der Wegwerfgesellschaft steht also zunehmend eine Gesellschaft gegenüber, die einen persönlichen Rückbezug zur Natur wagt, um wirtschaftliche Abhängigkeiten zu verringern. Bei uns lebende Türken bauen genau wie die Menschen im russischen St. Petersburg auch aus Geldmangel Gemüse an. Lateinamerikanische Einwanderer etablierten in ihrem verarmten Stadtteil die “South Central Farm” auf einer Brachfläche, um besser versorgt zu sein. Not macht erfinderisch, sagt man. Aber es ist wohl auch die Erkenntnis, dass wir ohne Naturkontakte nicht überleben können, die das urbane Gärtnern so erfolgreich gemacht hat.